Rezension: “Das Genie” von Klaus Cäsar Zehrer
Der hohe Preis der Genialität
Zugegeben, das mit Zehrers Das Genie und mir, das war nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick. Auch nicht auf den zweiten. Wohl eher auf den dritten. Es hat nämlich etwas länger gebraucht, bis wir uns gefunden haben. So richtig angesprochen hat mich der Klappentext anfangs nicht und ich war mir generell nicht sicher, ob die Geschichte etwas für mich sein könnte. Vermutlich hätte ich mir das Buch also nicht zwangsläufig zugelegt, aber letztendlich landete es dann (glücklicherweise!) doch hier, weil es meine Mutter lesen wollte. Nachdem ich dann einige durchweg positive Rezensionen gelesen hatte, war dann meine Neugier doch geweckt, also habe ich den Roman mal eben kurz ausgeliehen. Dank Klaus Cäsar Zehrers lebhaften Schreibstils waren die ersten hundert Seiten im Nu gelesen und ich war völlig eingenommen von der sagenhaften Geschichte über ein Genie, das keines sein wollte.

Sagenhaft mutet das, was Zehrer in seinem Debutroman erzählt, tatsächlich an, doch liegt dem Ganzen nichts als die Realität zugrunde: Zehrer hat hier die wahre Lebensgeschichte von William James Sidis fiktionalisiert und damit dessen tragisches Schicksal vor dem drohenden Vergessen bewahrt. Zehrer beginnt seine Erzählung mehr als ein Jahrzehnt vor der Geburt des eigentlichen Protagonisten, und zwar mit der Ankunft seines Vaters Boris in New York im Jahre 1886. Der junge, ambitionierte und vor allem hochintelligente Einwanderer aus der Ukraine lebt den amerikanischen Traum: Er baut sich nur mithilfe seines außerordentlichen Intellekts aus dem Nichts eine Existenz auf, etabliert sich als einflussreicher Forscher in einer noch jungen Wissenschaft, der Psychologie, und findet in der ehrgeizigen Sarah – ebenfalls Kind jüdischer Einwanderer aus der Ukraine – eine Partnerin, die ihn tatkräftig unterstützt. Boris Sidis plant nämlich eine Revolution im Bildungsbereich: Mittels einer selbstentwickelten Erziehungsmethode soll jedes Kind zum Genie erzogen werden können – sein Sohn William dient ihm dabei als Versuchs- und Vorführobjekt. Und die strengen Sidis’schen Bildungsmaßnahmen scheinen zu fruchten, denn William wächst zu einem wahren Wunderkind heran. So beginnt er mit gerade einmal elf Jahren sein Studium und wird umgehend als „Wunderjunge von Harvard“ gefeiert. Doch der junge Mann sieht sich immer weniger imstande, einem gewöhnlichen Leben nachzugehen, was nicht nur an seiner mangelnden sozialen Kompetenz liegt, sondern vielmehr an seinem zweifelhaften Prominentenstatus und den gesellschaftlichen Forderungen, die an ihn gestellt werden. Verzweifelt versucht William, dem familiären und öffentlichen Druck zu entkommen und ein normales und vor allem selbstbestimmtes Leben zu führen.
Angesichts der Komplexität von Williams Geschichte und der unzähligen Faktoren, die seine Situation bedingten, handelt es sich um eine wahre Mammutaufgabe, derer sich Klaus Cäsar Zehrer hier angenommen hat. Doch die Energie, die der Autor in die Recherche gesteckt hat, und all sein Herzblut für Sidis’ Schicksal sind jeder einzelnen der 650 Seiten anzumerken. So mag die hohe Seitenzahl zwar anfangs durchaus abschrecken, aber eben weil Zehrer die Geschichte so passioniert und empathisch sowie mit einer unheimlich lebendigen und leichtfüßigen Sprache erzählt, merkt man überhaupt nicht, dass es sich hier um einen dicken Schmöker handelt. Gerade die ersten paar hundert Seiten lesen sich besonders zügig, da in den Erzählungen über Boris’ Werdegang und sein Unverständnis für die offensichtliche Dummheit seiner Mitmenschen sowie in den Beschreibungen von Williams Kindheit und Besserwisserei auch stets viel Humor mitschwingt. Die zweite Hälfte und vor allem der dritte Teil des Buches muten hingegen, obwohl mindestens genauso flüssig geschrieben, etwas schwerfälliger an und sind ein bisschen schwerer verdaulich, allerdings ist dies nur konsequent, schließlich werden hier Williams beschwerlicher Weg der Selbstfindung und seine verzweifelten Versuche der Emanzipation von seinen Eltern sowie von den gesellschaftlichen Zwängen geschildert.
Aufgrund der vielen verschiedenen Situationen und der damit verbundenen vielfältigen Stimmungen, die dieses Buch ausgezeichnet transportiert, durchläuft man beim Lesen folglich die volle Bandbreite an Gefühlen: Mal schmunzelt man über Sarahs trotzige Versuche, den unnahbaren Boris für sich zu gewinnen, mal staunt man darüber, wie ein Kleinkind Zeitunglesen und mehrere Fremdsprachen beherrschen kann, mal ist man fassungslos angesichts der kühlen Berechnung und Herzlosigkeit, mit der die Eltern ihr Kind erziehen, mal ist man völlig fasziniert von Williams selbstentwickelten Theorien, während man gleichzeitig angesichts seiner mangelnden Sozialkompetenz und Manieren den Kopf schüttelt, mal empört man sich mit William über die Ellbogengesellschaft und die Rücksichtslosigkeit der Presse, mal belächelt man Williams Besessenheit von Straßenbahntickets und ein andermal tut es einem wiederum im Herzen weh, Zeuge davon zu werden, wie dieser außergewöhnliche Mensch eben gerade wegen seiner Eigentümlichkeit keinen Platz in der Gesellschaft findet. Die folgenden zwei Textausschnitte schildern Williams vertrackte Situation besonders deutlich:
„Billy gehörte nur halb dazu, wie auch schon im Studentenwohnheim, in der Schule und in jeder anderen Gruppe, zu der er je Zugang gehabt hatte. Überall war er Mittelpunkt und Randfigur zugleich.“ (S.333)
„All diese Leute, dachte William, waren normal, ohne dass es sie Anstrengung kostete. Die Normalität fiel ihnen so leicht wie ihre Muttersprache. Seine Muttersprache war die Außergewöhnlichkeit. Das war der Fluch seines Lebens: Es gab niemanden, mit dem er sich in seiner Sprache unterhalten konnte. Zwar konnte er sich bemühen, die Grammatik der Normalität zu lernen, aber er würde immer kleine Fehler machen, die die Muttersprachler, die Eingeborenen im Land der Normalität, sofort bemerkten. Sie ahnten ja nicht, wie schwierig es für ihn war, sich ihnen anzupassen.“ (S.482)
Mit solchen Szenen und generell als Gesamtwerk konfrontiert Das Genie den Leser mit allerlei ethischen und moralischen Fragestellungen und regt den Leser fortdauernd zum Nachdenken an. Wie sieht die „richtige“ Erziehung aus? Wie viel Maß an Bildung ist gut, wann ist es zu viel? Was ist Bildung wert? Ist das Bildungs- bzw. Schulsystem zu unflexibel? Und so weiter. Doch die Bildungsdebatte ist zwar das zentralste, aber letztendlich nur eines der vielen großen Themen, die Zehrer hier anspricht und die sich um Fragen drehen, die die Welt bewegen: Was und wer ist “normal”? Was und wer ist “unnormal”? Wie sollte man sein Leben führen? Wie sieht „das perfekte Leben“ aus bzw. gibt es das überhaupt? Und was genau ist Glück? Spannend gestalteten sich auch die Debatten im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen und Boris’ und Williams Standpunkt gegenüber dem Krieg(sdienst). Nicht zuletzt regt Zehrers Roman seine Leser auch dazu an, sich weiter Gedanken über Persönlichkeitsrechte und das (vermeintliche?) Recht eines Einzelnen auf Selbstbestimmung zu machen. Das Schöne ist hier vor allem, dass Zehrer zwar zahlreiche Fragen aufwirft, in vielen Fällen jedoch keine konkreten Antworten liefert, sondern höchstens mögliche Tendenzen aufzeigt, sodass man als Leser letztendlich seine eigenen Schlüsse ziehen kann bzw. soll.
Damit wirkt Zehrers Roman an keiner Stelle belehrend, nie hat es auch nur den kleinsten Anschein, als würde der Autor predigen – und das trotz all der philosophischen und wissenschaftlichen Themen, die behandelt werden. So schafft es Klaus Cäsar Zehrer hier nicht nur mühelos, beispielsweise vermutlich staubtrockene mathematische Gedankengänge verständlich und obendrauf kurzweilig darzustellen, sondern fast schon nebenbei einen Teil der amerikanischen Geschichte, den damaligen Zeitgeist und akademische Fortschritte jener Zeit äußert lebendig darzustellen. Auch seine Charaktere sind ihm ausgesprochen gut gelungen und das gilt besonders für die drei Hauptfiguren Boris, William und Sarah Sidis: Sie gehören zu der spannenden Sorte von Protagonisten, die sich nicht in „gut“ und „böse“ einordnen lassen, weil man sie einmal verabscheut und einmal bewundert oder auch bedauert, und die das Leseerlebnis deshalb umso interessanter machen. In dieser Hinsicht ist Das Genie vielschichtiger gestaltet als Joey Goebels Roman Vincent, zu dem es dennoch interessanterweise einige Parallelen aufweist und welcher Lesern, die an einer ähnlichen Thematik interessiert sind, an dieser Stelle ebenfalls empfohlen sei.

Klaus Cäsar Zehrer hat mit Das Genie ein vielversprechendes Debüt geliefert, das mit einer faszinierenden Geschichte glänzt, die nicht aktueller sein könnte, und auch mit einer bemerkenswert lebendigen und leichtfüßigen Sprache brilliert. Zwar hätte ich mir im dritten und letzten Teil des Buches, der im Ganzen etwas geraffter wirkt, das gleiche beachtliche Detailreichtum gewünscht wie in den anderen beiden Teilen, doch tat dies meinem insgesamt sehr positiven Leseeindruck keinen Abbruch. Mit seinem Debütroman hat Zehrer einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, deren Leben und Werk beinahe in Vergessenheit geraten sind, ein literarisches Denkmal gesetzt, das auch gewissermaßen als Mahnmal gegen den aktuellen Bildungswahn fungiert. Bei Das Genie handelt es sich damit um einen wertvollen Roman, der bestens unterhält und gleichzeitig zum Denken anregt – ein wahrer Geniestreich.
Weitere Rezensionen: Studierenichtdeinleben • Jules Leseecke
Habt ihr den Roman schon gelesen?
Oder habt ihr davor schon einmal etwas über William James Sidis oder der “Sidis-Methode” gehört?
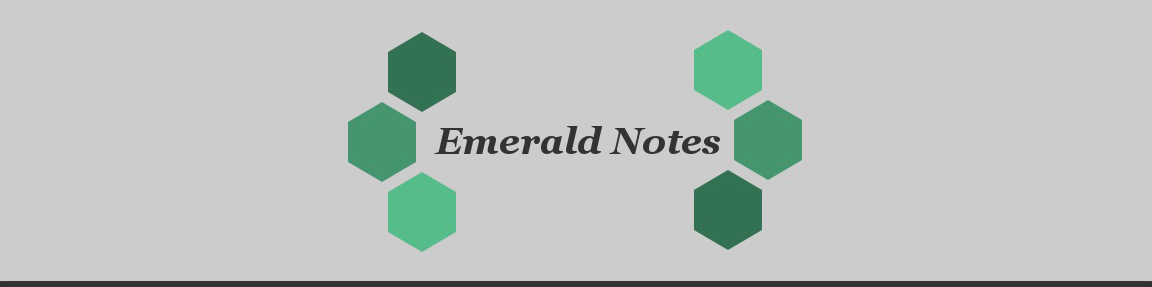




Kommentare