Rezension: “Das Feld” von Robert Seethaler
Ein Totenkonzert über das Leben
Unerträglich lange musste ich nach dem Erscheinen des neuen Romans von Robert Seethaler warten, bis ich ihn endlich selbst in den Händen halten und lesen konnte. Um diese Erfahrung vielleicht auch gewissermaßen zu kompensieren, habe ich das Buch dann innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal gelesen. Trotzdem hat es jetzt auch mit der Rezension länger gedauert als ursprünglich geplant. In der Zwischenzeit habe ich auch bereits über die Lesung von Robert Seethaler bei Ravensbuch berichtet. Der Roman selbst musste jedoch eine ganze Weile in mir nachklingen und auch ich musste erstmal meine Gedanken und Gefühle dazu sortieren. Ob ich überhaupt die richtigen Worte für dieses Meisterwerk finden kann? Ich möchte es jetzt einfach einmal versuchen…
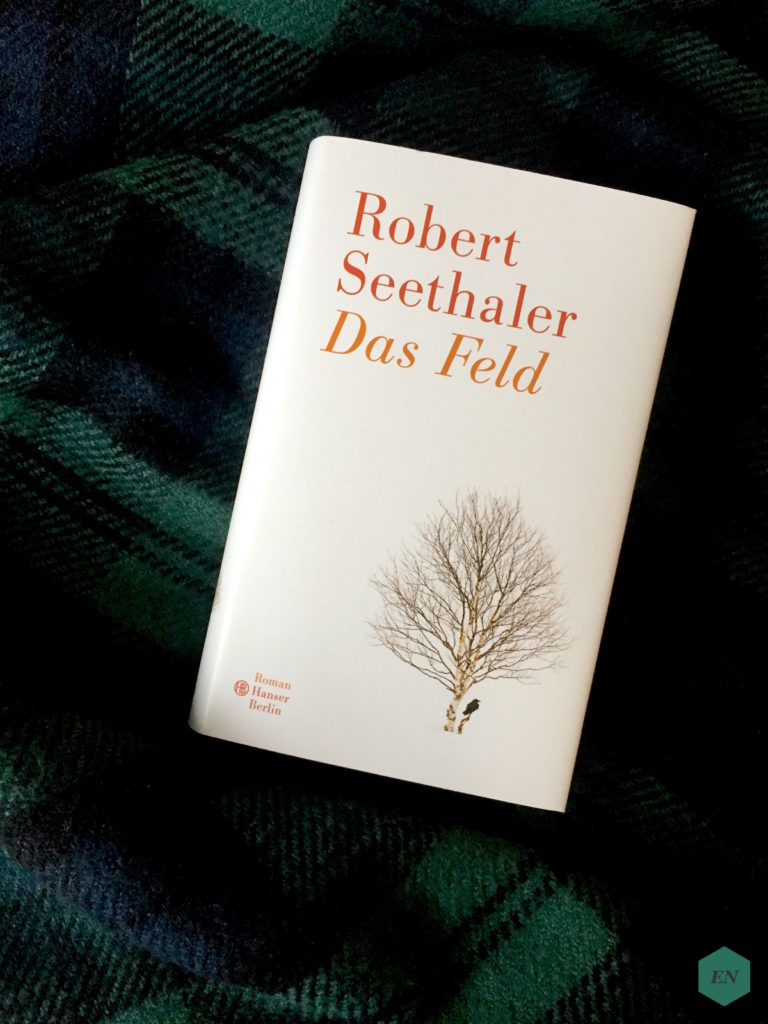
Was bleibt von einem Leben? Dieser Frage geht Robert Seethaler in Das Feld nach. Eine richtige Antwort darauf ist zwar unmöglich, doch Seethaler versucht, zumindest Ansätze dafür zu liefern, indem er 30 fiktive Tote auf ihr Leben zurückblicken lässt. Ausgelöst wird diese Rückschau durch einen Mann, den Erzähler, der seine Tage auf einer „Holzbank unter einer krummgewachsenen Birke“ (S.7) auf dem Friedhof verbringt, der in dem Ort – einer fiktiven Kleinstadt namens „Paulstadt“ – als „Das Feld“ bekannt ist. Dort sitzt er und macht sich so viele Gedanken über die Toten, die er zu Lebzeiten teilweise selbst gekannt hat, bis er irgendwann glaubt, sie tatsächlich reden hören zu können. Er stellt sich vor, wie es wäre, den Toten die Möglichkeit zu geben, ein letztes Mal ihre Stimme zu erheben – und genau das passiert dann auch: Ein/e verstorbene/r Paulstädter/in, der/die auf „dem Feld“ die letzte Ruhe gefunden hat, nach dem/der anderen tritt auf und erzählt – und am Ende reiht sich auch der Erzähler selbst, den wir dann als Harry Stevens kennenlernen, in diesen Totenreigen ein.
Über das, was jeweils von ihrem Leben bleibt, und vor allem über ganz bestimmte, prägende Erlebnisse berichten die Toten aus Paulstadt auf ganz unterschiedliche Weise: In kleinen Geschichten, Anekdoten, Lebensweisheiten, Reden und sogar „Dialogen“, aber oftmals auch in Gedankenfragmenten, Momentaufnahmen, Gefühlserinnerungen – mal über mehrere Seiten hinweg, mal kompakt auf einer Seite oder auch nur in einem einzigen Wort, wie im Fall der Trafikantin Sophie Breyer, deren letztes Wort nur „Idioten“ lautet. Jedes Kapitel trägt hierbei den Namen eines/einer ehemaligen Paulstädters/in und fast könnte man meinen, es handle sich hierbei um 30 Kurzgeschichten, doch die einzelnen Kapitel werden nicht nur durch die Rahmengeschichte um den alten Mann auf der Bank, dessen Kopf die Stimmen der Toten überhaupt erst entspringen, gewissermaßen zusammengehalten, sondern auch von einem groben Netz, das für den aufmerksamen Leser mit der Zeit immer klarer wird: Als Anwohner/innen derselben Stadt bestehen zwischen ihnen Verbindungen, viele von ihnen waren einst Nachbarn, Kollegen, Geliebte, befreundet, verwandt oder gar verheiratet. Und so entsteht aus den einzelnen Stücken, ja Fragmenten, langsam auf der einen Seite das Porträt einer Kleinstadt mit all ihren sozialen Schichten, auf der anderen aber auch eine Art Skizze vom Leben in all seinen Facetten und Ausprägungen.
Da gibt es in Das Feld beispielsweise die Frau mit der verkrüppelten Hand, die sich im Moment ihres Sterbens an ihre große Liebe erinnert, den irren Pfarrer, der in seiner Verzweiflung die Kirche abbrennt, den arabischen Gemüsehändler, der seinen Eltern die letzte Ehre erweisen möchte, oder einen Vater, der seinem Sohn noch ein paar Weisheiten mit auf den Weg geben möchte. In einigen Kapiteln geht es ganz direkt um Krankheit, das Sterben, die Vergänglichkeit und den Tod, in manchen nur zwischen den Zeilen, oft drehen sich die Lebensrückschauen der Toten um die Liebe und das Glück, andere hingegen um das Scheitern und verpasste Chancen – allzu große Bitterkeit oder Rührseligkeit klingt jedoch aus keinem der Kapitel. Und so behandelt Seethaler auch in seinem neuen Werk wie in seinem Vorgänger Ein ganzes Leben die ganz großen, aber eben auch die vielen kleinen Fragen des Lebens. Große Fußstapfen, die der Autor hier zu füllen hatte, doch es ist ihm gelungen, die Gratwanderung zwischen Sentimentalität und Abgeklärtheit, Melancholie und Witz, laut und leise zu meistern – eventuell sogar noch etwas gekonnter als zuvor. In dem schmalen Bändchen steckt so viel Poesie und Weisheit, dass man am liebsten ganze Absätze anstreichen würde. Hier nur eine kleine Auswahl:
Ich hasse sie für ihre Dummheit und ihre Schönheit. Ich hasse sie für das Wunder, das sie in sich tragen und an das sie hinter ihren glatten heißen Stirnen keinen einzigen Gedanken verschwenden.
Kann jemand zu ihnen gehen und ihnen sagen, sie mögen für immer bleiben? (S.108)
Ich hatte keine Kinder, und es hat mich nie gereut. Natürlich wäre ich neugierig gewesen, wie sich das anfühlt, wenn etwas von einem selbst in die Zukunft hinauswächst. Aber es ist nicht passiert. Obwohl die Männer gut zu mir waren. Was mich immer verwundert hat, denn ich war nicht gut zu den Männern. Ich habe sie ja nicht gekannt. Ich habe niemanden richtig gekannt, nicht einmal mich selbst. Erst war ich zu jung. Dann war ich zu stolz. Und schließlich zu alt. Wenn man alt ist, beginnt man zwar, hin und wieder etwas zu verstehen, aber es nützt einem nichts mehr. (S.183)
Ich wünschte, ich hätte genauer hingesehen. Ich wünschte, ich hätte weniger genau hingesehen. Ich wünschte, du könntest stolz auf mich sein. Sei mir nicht böse. Ich habe hinter Vorhänge geschaut. Zum Schluss habe ich den letzten Vorhang gelüftet und gesehen: Dahinter ist nichts. Ich wünschte, ich hätte nichts zu bereuen. Und das ist die ganze Wahrheit. (S.198f.)
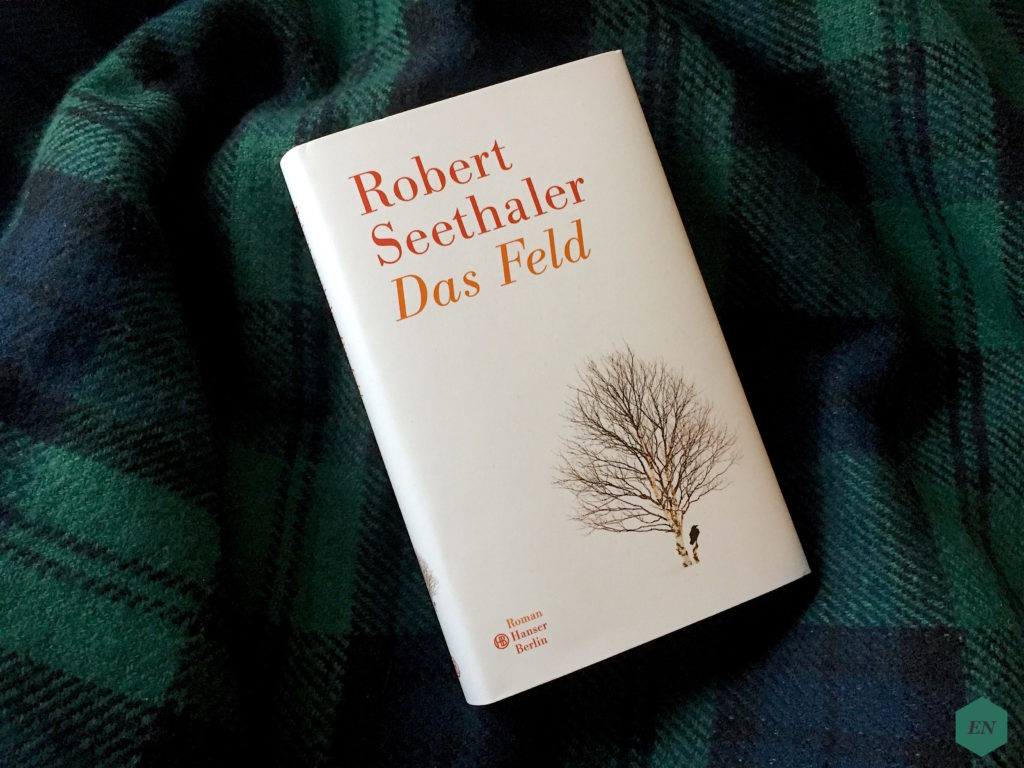
Einige Szenen, wie sie Seethaler beispielsweise in den Kapiteln „Hanna Heim“, „Stephanie Stanek“, “Susan Tessler“ oder „Annelie Lorbeer“ beschreibt, bewegen den Leser und klingen lange nach, bei anderen Geschichten, wie zum Beispiel die des korrupten Bürgermeisters Heiner Joseph Landmann, muss man wiederum unweigerlich schmunzeln, und manche – darunter „Franz Straubein“ und „Linda Aberius“ – entziehen sich dem Leser und bleiben (vorerst) ein Rätsel. All diese unterschiedlichen Lebensgeschichten erhalten dabei einen ganz eigenen Ton und Stil, jede Figur, jedes Mitglied im Chor der Toten erhält von Seethaler eine ganz individuelle und autonome Stimme. In ihrer Gesamtheit bilden die einzelnen Stimmen allerdings einen harmonischen Klangteppich und es entsteht ein vielfältiges, lebendiges und doch organisches Bild von dem, was das Leben ausmacht.
Annelie Lorbeer, eine der bemerkenswertesten Figuren in Das Feld, erinnert sich kurz vor ihrem Tod an einen bestimmten Satz, den sie als „wenn schon nicht für die Ewigkeit, so doch für den Augenblick“ (S.188) gemacht beschreibt. Im Falle von Robert Seethalers vielschichtigem, zutiefst bewegendem und wunderbar poetischem Roman trifft das auf umgekehrte Weise zu: Mit Das Feld hat der österreichische Autor ein Werk weniger für den Augenblick, als vielmehr für die Ewigkeit geschaffen.
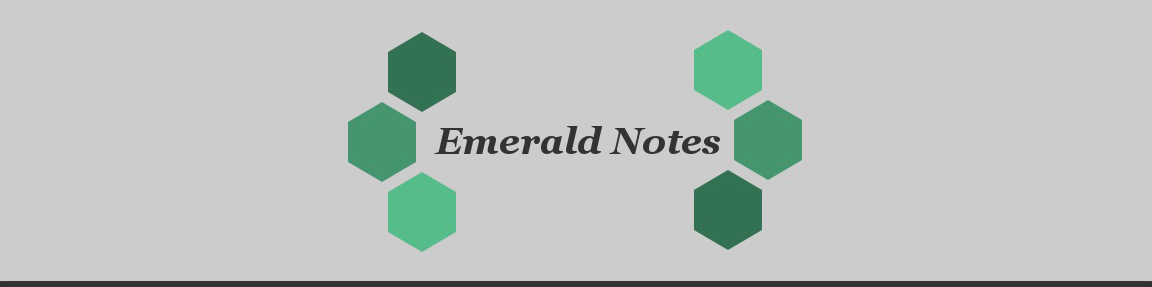

0 Comments