Rezension: “Tell” von Joachim B. Schmidt
Ein Epos wie für die Kinoleinwand gemacht
Etliche Generationen von Schüler:innen haben wohl schon Friedrich Schillers bekanntes Drama Wilhelm Tell gelesen. Dazu gehöre auch ich. Die Lektüre liegt in etwa schon mein halbes Leben zurück und vielleicht mag der Zeitfaktor einer der Gründe sein, weshalb ich das Stück nur noch blass in Erinnerung habe. Andere Schullektüren sind mir jedoch viel lebhafter im Gedächtnis geblieben – ganz im Gegensatz wiederum zu einer Freilichtaufführung des Dramas, die zwar noch nicht ganz so lange zurückliegt, aber offenbar auch wenig eindrücklich gewesen sein muss. Was ich allerdings fast sicher weiß: An den Roman Tell, eine kürzlich erschienene Quasi-Generalüberholung bzw. Neuauflage der Schweizer Nationalsaga aus der Feder des in Island lebenden eidgenössischen Autors Joachim B. Schmidt werde ich mich hingegen vor allem aufgrund der bemerkenswert bildhaften und plastischen Erzählweise bestimmt noch viele Jahre erinnern.

Zurückgezogen von den umliegenden Dörfern lebt Wilhelm Tell mit seiner Familie auf einem alten Bauernhof in der Einöde der Schweizer Alpen. Das Leben auf dem Tell-Hof ist hart und entbehrungsreich, denn die Vieh- und Landwirtschaft ist nur noch wenig ertragreich. Während sich die beiden Söhne um die Kühe kümmern und Ehefrau, Mutter und Schwiegermutter auf die kleine Tochter und das Haus aufpassen, zieht es den eigenbrötlerischen, grüblerischen und wortkargen Tell zur Jagd in die Berge. Als Kind schwer traumatisiert und gezeichnet vom fürchterlichen Tod seines jüngeren Bruders, für den er sich die Schuld gibt, kann er in der kargen Berglandschaft weder den Schatten seiner Vergangenheit entkommen, noch hat man dort seine Ruhe vor der Tyrannei der Habsburger, die dem Bergvolk das Leben nur noch schwerer machen. Nach der verhängnisvollen Begegnung zwischen Tell sowie seinem älteren Sohn Walter, die in den Bergen einen Bären verfolgten, und Landvogt Gessler und seinem skrupellosen Häscher Harras, hat es Letzterer auf den unbeugsamen Bauern abgesehen und setzt damit eine beispiellos mörderische Kettenreaktion der Gewalt und Gegengewalt in Gang, die scheinbar alles und jeden mit sich reißt und schier nicht mehr aufzuhalten ist, bis Tell zum Held wider Willen wird.
Obwohl mich Joachim B. Schmidts Diogenesdebüt Kalmann recht unerwartet extrem begeistert hatte, war ich angesichts des doch recht überschwänglichen Ankündigungs- und plakativen Klappentextes zum Nachfolger Tell zunächst etwas skeptisch. Ob dieser unter anderem als „Blockbuster“, „atemberaubendes Kopfkino mit Suchtfaktor“, „Thriller“ und „Pageturner“ angepriesene sowie als „The Revenant in den Alpen, Game of Thrones in Altdorf“ beschriebene Roman solch hochtrabenden Vorschusslorbeeren gerecht würde? Da ich den Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle noch nicht gesehen habe, vermag ich zwar nicht zu beurteilen, ob dieser Vergleich zutrifft, doch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der rohen Welt und den ungleichen Machtverhältnissen aus Game of Thrones und der von Schmidt gezeichneten Alpenwelt samt deren Bewohnern ist tatsächlich auszumachen. Obwohl sich der Roman für mich persönlich nicht als „Pageturner“ oder „Thriller“ las – wohlgemerkt im Gegensatz zu vielen anderen Leser:innen, die das Buch offenbar kaum aus den Händen legen konnten (trotz einiger, teils auch sehr überraschenden Änderungen/Neuerungen gegenüber der bekannten Erzählung war für mich dennoch recht schnell klar, worauf die Geschichte hinauslaufen würde) –, ist die suggerierte Nähe zu Film und Kino auf alle Fälle zutreffend: In 100 kurzen Sequenzen, die oft lediglich eine oder ein paar wenige Seiten umfassen und rasant wechseln, steuert Joachim B. Schmidt aus der Perspektive von 20 verschiedenen Figuren und mit einer unvergleichlich bildgewaltigen Sprache auf einen filmreifen Showdown hin, der mindestens so leinwandtauglich ist wie unzählige weitere extrem plastisch geschilderte Szenen. Selten ist mir ein Buch untergekommen, das in jeder Zeile einfach so deutlich fürs bewegte Bild (Film oder Serie, da kann ich mir beides gut vorstellen) gemacht war – und wenn dieser so moderne Tell nicht verfilmt wird, dann weiß ich wirklich auch nicht!
Der Aufbau des Romans mit seinen vielen verschiedenen Perspektiven und dennoch meist sehr kurzen Kapiteln ist zunächst ungewohnt, doch man findet schnell in den Lesefluss rein, wie ich finde. In den meisten Fällen bin ich nicht der allergrößte Fan von Geschichten, die aus der Sicht von mehr als zwei bis drei Figuren erzählt werden und tendiere dann dazu, die Kapitel von mir weniger sympathischen Figuren am liebsten überspringen zu wollen (so geschehen bei den ersten beiden Bänden der A Song of Ice and Fire (besser bekannt als Game of Thrones)-Reihe von George R. R. Martin, weshalb ich diese dann auch abgebrochen habe), doch in Tell hat mich der Wechsel zwischen den 20(!) verschiedenen Perspektiven kein bisschen gestört. Das liegt vermutlich auch daran, dass es im Wesentlichen keine allzu großen Sprünge, sprich Ortswechsel, zwischen den einzelnen Kapiteln gibt, da die jeweils nächste Figur meistens schon beim geschilderten Geschehen dabei ist oder sich zumindest in der Nähe befindet und es darüber hinaus immer einen klaren Fokus, ja einen roten Faden gibt: Tell. So viel erfahren wir über ihn durch die Gedanken und Beobachtungen anderer und sehen ihn lange nur aus den Augen seiner Familie, Nachbarn, Bekannter und Rivalen, die ihn zum Beispiel folgendermaßen beschreiben:
Ach, er ist ein braver Bub. Aber anders. Ein stiller, seltsamer Kerl. Das ist er schon immer gewesen, aber er tut sein Bestes. Gewiss. Auch er kniet sich ans Bett, schaut mich an, schaut mich so richtig an, was mich überrascht, denn meistens schaut er an einem vorbei. Was sich in seinem Kopf abspielt, ist mir ein Rätsel. (Grosi Marie, S. 86)
Früher habe ich ihn bewundert, auch wenn ich schon immer ein wenig Angst vor ihm gehabt habe. Wieso ist er nicht so wie andere Männer? Vater Taufer etwa oder der Bauer vom Birkihof. Vater gleicht einem Berg. Man kann ihn nicht verrücken, an ihm entladen sich die Gewitter, und er wirft einen langen Schatten. Er lacht nie, und ich glaube, er mag niemanden. (Walter, S. 96)
Den bringt nichts aus dem Gleichgewicht, nicht mal einen schwimmende Kuh. (Birki, S. 141)
Da steht, so Gott will, der Bergbauer von neulich. Der Bart, das zerzauste, fettige Haar und die schwarzen Augen. Diesen feindseligen flackernden Blick werde ich nie vergessen. (Gessler, S.154)
Tell selbst kommt tatsächlich erst kurz vor Schluss zu Wort. Ursprünglich hätte er von Anfang an dabei sein sollen, doch die Szenen hätten sich, wie Joachim B. Schmidt bei einem Bloggertreffen von Diogenes verriet, so nicht stimmig angefühlt, weshalb er diese beim Schreibprozess schließlich wieder herausgestrichen und das Wichtigste über Tell den anderen Figuren in den Mund gelegt hätte. So wird die eigentliche Hauptfigur in dem Roman zum Beschriebenen: Die Geschichte zirkelt zwar permanent um ihn herum und alles dreht sich letztendlich um Tell, doch so richtig nah kommt man ihm dennoch nie. Zugegebenermaßen habe ich mich auch lange recht schwer damit getan, bis zum Schluss das Gefühl zu haben, Tell als Charakter einfach nicht greifen zu können, obwohl ich ihn so gerne besser verstanden hätte, zumal man gerade bei einem solchen Titel zunächst vielleicht auch etwas anderes erwartet hätte. Nachdem die Lektüre des Romans mittlerweile aber schon wieder ein bisschen zurückliegt, muss ich sagen, dass ich Schmidt für diesen geschickten Kunstgriff immer mehr bewundere, je länger ich darüber reflektiere.

Letztendlich steht dieses Unerreichbare, das nicht Greifbare, die nicht zu überwindende Distanz zur Figur und das sprichwörtliche „Stochern im Nebel“ nämlich absolut im Einklang mit der Legende um Tell an sich: Indem sich seine Tell-Figur den Lesern entzieht und er – ohne nun zu viel vorwegzunehmen – ihn auch quasi wieder im Schleier der Geschichte verschwinden lässt, fügt sich Joachim B. Schmidt nahtlos in die Reihe der Erzählungen um den Tell-Mythos ein. Gleichzeitig gibt er ihm einen neuen, zeitgemäßeren Anstrich und pustet den teils zentimeterdicken Staub von seiner Oberfläche. Insbesondere gibt Schmidt seiner Tell-„Neuerzählung“ eine allgemeingültigere Note, schließlich wird wohl nie nachzuweisen sein, ob es genau diesen Bergbauern namens Wilhelm Tell so überhaupt jemals gegeben hat, aber im Gegenzug kann man von vielen ähnlichen Schicksalen zur damaligen Zeit ausgehen. Und so stellt kein Geringerer als der Ur-Bösewicht Gessler, dessen klischeehafte Rolle in Schmidts Tell im Übrigen von jemand anderem besetzt wird, letztendlich fest: „Sie alle sind Tell.“ (S. 246) All die – tatsächlich sogar weit über – 20 Charaktere, die die manchmal mehr an Island als an die Schweiz erinnernde raue Berglandschaft in Schmidts Roman bevölkern, sind also Tell und der Autor beschreibt sie alle so plastisch, dass sie bisweilen fast von den Buchseiten springen. Wie gesagt, hier liegt bereits ideales Material für eine filmische Adaption vor, die bestimmt mindestens so beeindruckend wäre wie die Romanvorlage. So oder so freue ich mich auf die weiteren Werke dieses vielversprechenden Autors, der einfach so verflucht gut schreibt, dass sicherlich so manche/r Schüler:in in Zukunft, wenn die Schweizer Nationalsaga auf dem Lehrplan steht, nach dem Lesen von Schmidts Tell fragen wird: „Schiller, who?“
Werbung – Vielen Dank an dieser Stelle an den Diogenes Verlag für das Leseexemplar und die Möglichkeit, dieses Buch besprechen zu dürfen.
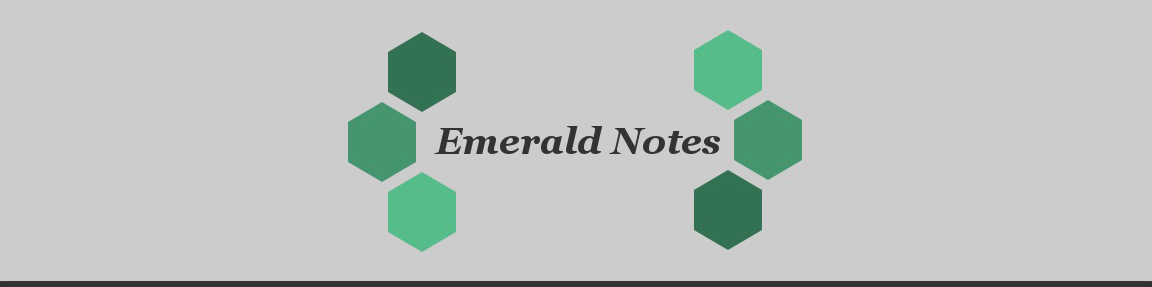
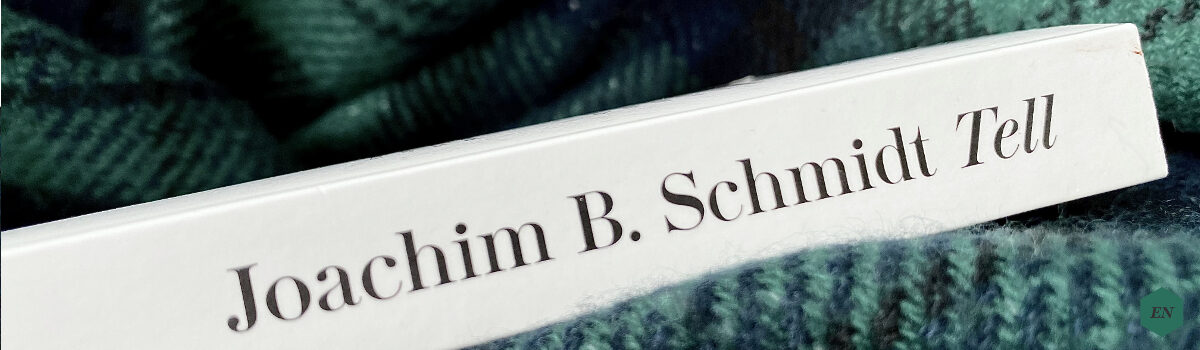
0 Comments